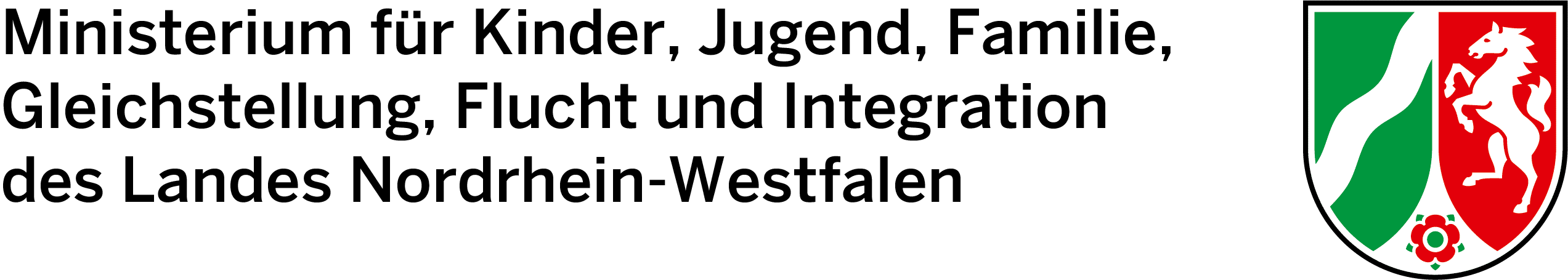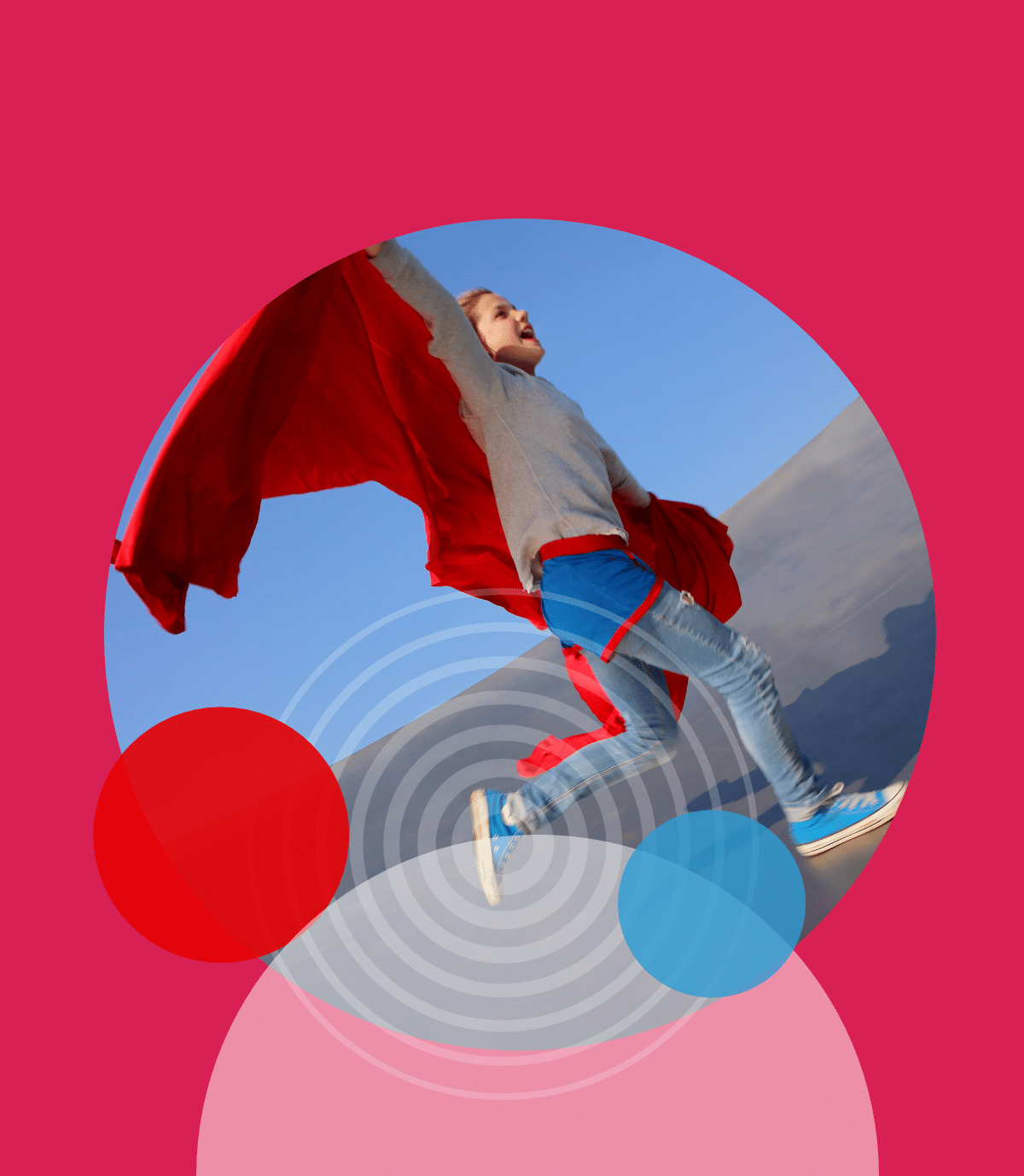
Thema:
Schutzkonzepte
Orte kultureller Bildung müssen sich selbst als Orte wahrnehmen, an denen es zu Missbrauch kommen könnte. Präventives Denken und Handeln ist hier wichtig.

Claudia Keuchel
Leitung
keuchel@kulturellebildung-nrw.de
02191 794-373

Vera Götte
Stellvertretende Leitung
goette@kulturellebildung-nrw.de
02191 794-374
Prävention und Schutzkonzepte
Kinder und Jugendliche müssen auch in Angeboten der kulturellen Bildung zuverlässig vor sexualisierter Gewalt und allen Arten von Grenzverletzungen geschützt sein. Die Orte der kulturellen Bildung nehmen sich selbst jedoch noch viel zu selten als Orte wahr, an denen es zu Missbrauch kommen könnte. Und doch ist präventives Denken und Handeln auch hier wichtig. Zugleich gilt es auch, für Anzeichen von Machtmissbrauch innerhalb der Gruppen oder außerhalb der Institutionen zu sensibilisieren und Sicherheit im Umgang mit der Situation zu schaffen.
Warum wir als Kulturakteur*innen Schutzkonzepte brauchen
Schutzkonzepte geben Handlungssicherheit
Schutzkonzepte in der kulturellen Bildung schaffen sichere Räume für Kinder und Jugendliche, in denen sie ihre kreativen Fähigkeiten entfalten und sich persönlich entwickeln können. Präventionsmaßnahmen in der kulturellen Bildung tragen dazu bei, dass junge Menschen Erfahrungen in Kunst und Kultur ohne Angst vor Gewalt oder Missbrauch machen können.
Aus diesem Grund engagieren sich viele Organisationen und Initiativen aktiv für die Sicherheit und das Wohl junger Menschen in der kulturellen Bildung. Sie entwickeln maßgeschneiderte Schutzkonzepte, die auf ihre spezifische Praxis zugeschnitten sind.
Ein Schutzkonzept richtet den Blick darauf, wie Kinder und Jugendliche vor jeglicher Form von Kindeswohlgefährdung geschützt bzw. unterstützt werden können, wenn sie davon betroffen sind. Schutzkonzepte sind notwendig, um Handlungssicherheit zu bieten. Sie sollten Schutzprozesse sein, die in die eigene Arbeit integriert werden und kontinuierlich weiterentwickelt werden.
Schutzkonzepte umfassen Präventionsmaßnahmen, die Aufarbeitung von Übergriffen und die Kommunikation mit Eltern und Kooperationspartnern. Sie sensibilisieren für das Thema Kindeswohlgefährdung und signalisieren potenziellen Tätern, dass achtsam gehandelt wird. Wichtig ist, dass Kulturakteur*innen nicht alleine handeln müssen, sondern auf gesetzliche Rahmenbedingungen und Unterstützungsstrukturen zurückgreifen können.