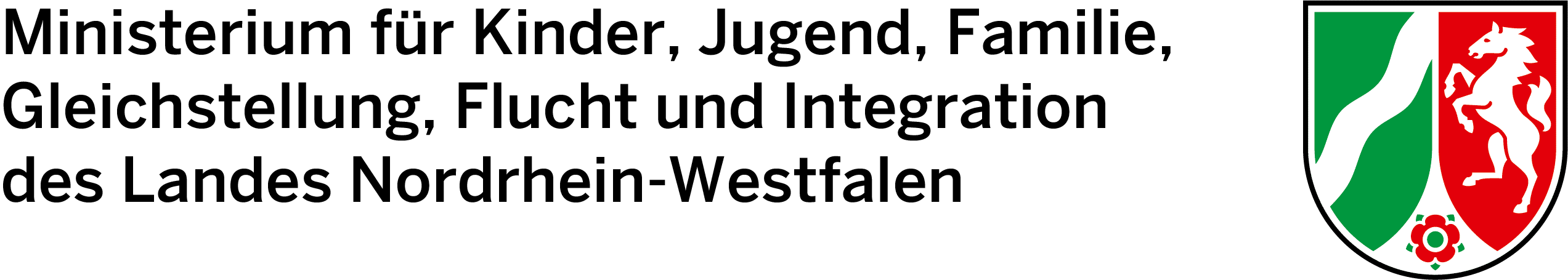Foto: Mona Nielen
Kawthar El-Qasem studierte Architektur an der FH und Baukunst an der Kunstakademie Düsseldorf. An der Bauhaus-Universität Weimar hat sie im Rahmen der sozialwissenschaftlichen Stadtforschung promoviert. Parallel zu ihren Tätigkeiten im Bereich Architektur hat Kawthar El-Qasem eigene Demokratie- und Bildungsprojekte entwickelt und umgesetzt, zuletzt als Projektreferentin für die Opferberatung Rheinland. Seit 2020 leitet sie den Fachbereich baukultureller Bildung an der Akademie der Kulturellen Bildung in Remscheid.
1. Baukultur und kulturelle Bildung ist jetzt nicht gerade etwas, das man sofort in einem Atemzug nennt. Wie und wo siehst du für dich die Verknüpfung?
Wenn wir auf die Definitionen Kultureller Bildung schauen, die sich ja unterscheiden, gehört doch immer dazu, sich mit kulturellen Ausdrucksformen zu beschäftigen und sich in der Welt zu positionieren. Schlagwörter wie Teilhabe und Partizipation, Demokratielernen, gesellschaftlicher Zusammenhalt und Mitgestaltung spielen eine Rolle. Da wundert es eher, dass Baukultur bisher so wenig mitgedacht wird. Denn genau hier finden sich alle diese Aspekte. Noch dazu können wir uns der Baukultur nicht entziehen. Sie ist einfach da Sie beeinflusst in hohem Maße, wie wir (zusammen)leben, wie wir die Welt denken (können) und wir sind selbst Teil davon. Umso wichtiger ist es, dass wir uns dieser Zusammenhänge bewusst werden, Strategien der Raumaneignung erlernen und erproben und gemeinsam ins Gespräch darüber kommen, wie wir (zusammen) leben möchten.
2. Baukulturelle Bildung und baukulturelle Themen wirken sich auf viele Gesellschaftsbereiche aus: naheliegend z. B. auf Umwelt, Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Handwerk. Aber auch auf Politik, Demokratie und Ethik. Gibt es aus deiner Sicht einen Bereich, in dem der Einfluss besonders ausgeprägt ist?
Genau das ist das Spannende an der Baukultur. Sie vereint all diese Themen. Und meiner Meinung nach lassen sie sich nicht voneinander trennen. Sie getrennt zu denken hat seinen Preis, den wir inzwischen alle sehen. In Klimawandel und Ausbeutung, in Politikverdrossenheit und Entfremdung. Baukulturelle Bildung kann uns helfen, das Denken in getrennten Bereichen zu überwinden. Vielleicht liegt ja hier der Schlüssel für die Rückkehr hinter die Illusion, dass wir das Eine ohne das Andere haben können. Demokratie nicht ohne Ethik, Ethik nicht ohne Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit nicht ohne ein Verständnis für Material und Handwerk. Das stimmt mich optimistisch.
3. Inklusion, Diversität und Teilhabe und sind Begriffe, die wir aus der kulturellen Bildung kennen. Wie können wir uns Anknüpfungspunkte zur Baukultur vorstellen?
Klassischerweise könnten wir an ein rollstuhlgerechtes Gebäude denken. Aber es geht weit darüber hinaus. Mit den Methoden der baukulturellen Bildung können wir erforschen, welche Bedürfnisse im Raum sind, wie sich Behinderung im Raum materialisiert, wer sich eingeladen fühlt und wer nicht. Und wir können überlegen, wie wir das ändern können. In diesem Prozess sind neben der Selbstreflexion auch der Perspektivwechsel und die Empathie, aber auch das solidarische Moment gefragt. Oder wir lernen Spuren im Raum zu lesen, vielleicht Schichten freizulegen, die von einer vergangenen Diversität zeugen, die gegenwärtige Vielfalt zu erkennen und zu fragen, wie sie sich im Raum spiegeln könnte, und eine zukünftige Diversität zu entwerfen. Kurzum, wie muss der Raum sein, damit er die Teilhabe aller fördert oder ermöglicht?
4. Was gefällt dir an deiner Arbeit am meisten?
Der Fachbereich ist noch vergleichsweise jung, das Feld ist noch im Werden. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist natürlich, dass ich viel Mitgestalten kann. Ich sehe darin aber auch eine Verantwortung, das Thema baukulturelle Bildung voranzubringen und ein weites Verständnis zu erhalten, das sich an den Prinzipien der Kulturellen Bildung orientiert. Architekturvermittlung kann ein Teil sein, aber allein macht sie noch keine baukulturelle Bildung. Es macht mir Freude, neue Themen zu erschließen, Methoden zu entwickeln und im Austausch mit meinen Teilnehmer:innen und anderen Akteur:innen der baukulturellen Bildung. Gleichzeitig ist es unglaublich spannend, und da ist die Akademie ein toller Ort, die Synergie-Effekte mit anderen Sparten der Kulturellen Bildung zu nutzen. Ich habe hierzu auch die Qualifizierung „Interdisziplinäre Baukultur-Vermittlung“, denn Baukultur ist von Hause aus interdisziplinär. Sie ist nicht ohne Kunst, Theater, Tanz, Literatur oder Musik zu denken. Denn alles hat letztendlich mit Raum zu tun.
5. Woran arbeitest du zurzeit?
Derzeit bin ich in den finalen Arbeiten für die Publikation eines Sammelbandes beim kopaed Verlag. Ich freue mich ganz besonders über die vielen tollen Beiträge aus der Praxis und aus der Wissenschaft von Autor:innen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. Das Ziel ist eine Standortbestimmung für das Feld der baukulturellen Bildung, eine Reflexion auf der Meta-Ebene, aber auch ein voneinander lernen. Ich freue mich auf jeden Fall, das Buch im November in den Händen zu halten.